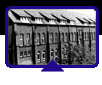![]() Einführung
Einführung
![]() Das
Werk
Das
Werk
![]() Spuren
der
Spuren
der
![]() Vergangenheit
Vergangenheit
![]() Das
„Arbeits-
Das
„Arbeits-
![]() erziehungslager“
erziehungslager“
![]() Biografische
Skizzen
Biografische
Skizzen
![]() Zeittafel
1935 - 1945
Zeittafel
1935 - 1945
![]() Zeittafel
nach 1945
Zeittafel
nach 1945
![]() Forschungsprojekt
Forschungsprojekt
![]() Dokumentationsstelle
Dokumentationsstelle
![]() Jugend AG
Jugend AG
![]()
Biografische
Skizzen
Mehr als 11.000 Fremd- und Zwangsarbeiter/innen wurden zum Ausbau der
Pulverfabrik Liebenau und zur Pulverproduktion im Werk herangezogen. Wir
wissen bis heute nur sehr wenig über die einzelnen Lebenswege dieser Menschen,
die aus den verschiedensten Nationen kamen. Sicherlich gingen einige zunächst
freiwillig in das ihnen fremde Land, geworben von den Versprechungen deutscher
Behörden oder im Zuge innerstaatlicher Vereinbarungen (z.B. Italiener).
Die meisten Frauen und Männer aber - vor allem diejenigen aus den osteuropäischen
Ländern - wurden gegen den eigenen Willen in das „Deutsche Reich“ verschleppt.
Stellvertretend für die vielen Betroffenen sollen an dieser Stelle einige
Menschen kurz vorgestellt werden:
Katerina
Derewjanko
 Katerina
Derewjanko lebte mit ihren Eltern und ihren drei Geschwistern in Konstantinovka,
einer ukrainischen Kleinstadt in der Nähe von Charkow. Im Frühjahr 1943
wurde Katerina in das „Deutsche Reich“ - zur Zwangsarbeit nach Liebenau/Steyerberg
- verschleppt. Von Mai 1943 bis Ende April 1945 musste sie im Steyerberger
„Ostarbeiterlager“ leben und unter schweren körperlichen und seelischen
Strapazen in der Pulverproduktion arbeiten. Sie hat in Liebenau/Steyerberg
mit ansehen müssen, wie zahlreiche Zwangsarbeiter/innen verhungerten,
erschlagen oder erschossen wurden. Erst im Juni 1945 konnte sie in ihr
Heimatland zurückkehren. Ihre jüngeren Geschwister waren im August 1943
- nach einer Razzia durch Wehrmachtsangehörige - ebenfalls in das „Deutsche
Reich“ abtransportiert worden. In täglich 12-stündiger Arbeit und unter
ständigem Hunger setzte die Firma Holzmann sie beim Bau eines Bunkers
in Berlin-Schöneberg ein. Dieser Bunker befindet sich heute noch auf dem
Gelände der Sophie-Scholl-Oberschule.
Katerina
Derewjanko lebte mit ihren Eltern und ihren drei Geschwistern in Konstantinovka,
einer ukrainischen Kleinstadt in der Nähe von Charkow. Im Frühjahr 1943
wurde Katerina in das „Deutsche Reich“ - zur Zwangsarbeit nach Liebenau/Steyerberg
- verschleppt. Von Mai 1943 bis Ende April 1945 musste sie im Steyerberger
„Ostarbeiterlager“ leben und unter schweren körperlichen und seelischen
Strapazen in der Pulverproduktion arbeiten. Sie hat in Liebenau/Steyerberg
mit ansehen müssen, wie zahlreiche Zwangsarbeiter/innen verhungerten,
erschlagen oder erschossen wurden. Erst im Juni 1945 konnte sie in ihr
Heimatland zurückkehren. Ihre jüngeren Geschwister waren im August 1943
- nach einer Razzia durch Wehrmachtsangehörige - ebenfalls in das „Deutsche
Reich“ abtransportiert worden. In täglich 12-stündiger Arbeit und unter
ständigem Hunger setzte die Firma Holzmann sie beim Bau eines Bunkers
in Berlin-Schöneberg ein. Dieser Bunker befindet sich heute noch auf dem
Gelände der Sophie-Scholl-Oberschule.
Pieter
Koop

Pieter Koop aus Huizum in den Niederlanden - obere Reihe, dritter von
rechts auf dem vermutlich im Steinlager Liebenau aufgenommen Gemeinschaftsfoto
- wurde am 26.09.1922 in Bergum (Friesland) geboren. Während der deutschen
Besetzung verhaftete man ihn im niederländischen Leeuwarden wegen „Fälschung
von Lebensmittelmarken“. Er wurde zur Arbeit nach Deutschland zwangsverpflichtet
und kam am 19.02.1943 nach Liebenau. Das Standesamt vermerkte über ihn:
"...eingesetzt bei Fa. Eibia in Liebenau...". Pieter war im Steinlager
Liebenau einquartiert. In einem seiner Brief an seine Familie berichtete
Pieter über die Arbeit bei der Eibia, und dass er „solche Dinge“ lieber
nicht produzieren wolle. Am 31.03.1943 floh er aus Liebenau, doch an der
niederländischen Grenze verhaftete man ihn. Er wurde in das KZ Neuengamme
als politischer Häftling mit der Nummer 19628 verschleppt. Pieter Koop
starb dort am 21. Januar 1944, wobei als Todesursache „Lungentuberkulose“
angegeben wurde.
Hildegard
A.
 Hildegard
A. - zweite von rechts, mit weiteren "Arbeitsdienstmaiden" im
Steinlager Liebenau - wurde am 02. Juli 1924 in der Nähe von Hildesheim
geboren. Nach dem Volksschulbesuch erlernte sie den Beruf der Friseurin.
Im Anschluss an die Lehre kam sie am 08. April 1943 zum Reichsarbeitsdienst,
wobei man sie der Landarbeit in der Ortschaft Ströhen zuwies. Mit
insgesamt 90 weiteren Mädchen arbeitete sie auf den Höfen der
näheren Umgebung des Ortes. Vom 29. Oktober 1943 bis zum 20. Mai
1944 verrichtete Hildegard A. den Kriegshilfsdienst in der Pulverfabrik
Liebenau, wobei sie in einem Haus des Steinlagers Liebenau mit vier weiteren
Mädchen in einer Stube untergebracht war. Im Verlauf ihrer Dienstzeit
bei der Eibia GmbH wog, mischte und verpackte sie die sogenannten Ring-
oder Blättchenpulver, wobei sie Vorarbeiterin für russische
Frauen war. Wie diese litt auch sie unter den Verfärbungen der Haare
und der Haut, die aus dem Umgang mit den chemischen Substanzen resultierten.
Hildegard A. erinnert sich an die gute Verpflegung für die deutschen
Mädchen. Sie weiß aber auch zu berichten, dass zu diesem Zeitpunkt
vor allem die italienischen Arbeitskräfte des Werkes besondere Not
gelitten hätten und körperlich sehr geschwächt waren. Nachdem
die Italiener/innen einige Jahre zuvor noch als Verbündete der Deutschen
bevorzugt waren, galten sie nun als Verräter. Italien hatte den Pakt
mit dem "Reich" im Jahr 1943 verlassen.
Hildegard
A. - zweite von rechts, mit weiteren "Arbeitsdienstmaiden" im
Steinlager Liebenau - wurde am 02. Juli 1924 in der Nähe von Hildesheim
geboren. Nach dem Volksschulbesuch erlernte sie den Beruf der Friseurin.
Im Anschluss an die Lehre kam sie am 08. April 1943 zum Reichsarbeitsdienst,
wobei man sie der Landarbeit in der Ortschaft Ströhen zuwies. Mit
insgesamt 90 weiteren Mädchen arbeitete sie auf den Höfen der
näheren Umgebung des Ortes. Vom 29. Oktober 1943 bis zum 20. Mai
1944 verrichtete Hildegard A. den Kriegshilfsdienst in der Pulverfabrik
Liebenau, wobei sie in einem Haus des Steinlagers Liebenau mit vier weiteren
Mädchen in einer Stube untergebracht war. Im Verlauf ihrer Dienstzeit
bei der Eibia GmbH wog, mischte und verpackte sie die sogenannten Ring-
oder Blättchenpulver, wobei sie Vorarbeiterin für russische
Frauen war. Wie diese litt auch sie unter den Verfärbungen der Haare
und der Haut, die aus dem Umgang mit den chemischen Substanzen resultierten.
Hildegard A. erinnert sich an die gute Verpflegung für die deutschen
Mädchen. Sie weiß aber auch zu berichten, dass zu diesem Zeitpunkt
vor allem die italienischen Arbeitskräfte des Werkes besondere Not
gelitten hätten und körperlich sehr geschwächt waren. Nachdem
die Italiener/innen einige Jahre zuvor noch als Verbündete der Deutschen
bevorzugt waren, galten sie nun als Verräter. Italien hatte den Pakt
mit dem "Reich" im Jahr 1943 verlassen.
Jouke
Wind
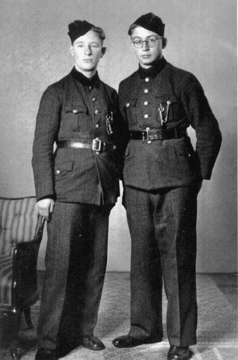 Das Foto
zeigt Jouke Wind (rechts), geboren am 01. März 1924 in Uereterp/Niederlande,
in Liebenau mit seinem damaligen besten Freund Folkert St. in der Uniform
der Eibia-Betriebsfeuerwehr. Jouke hatte zuvor im Raumausstattergeschäft
seines Vaters gearbeitet. Im Jahr 1941 überprüften deutsche
Besatzungsbehörden die niederländischen Betriebe und Unternehmen
der Umgebung gezielt nach "überzähligen" Arbeitskräften.
Die somit Aussortierten wurden zur Arbeit ins "Deutsche Reich"
zwangsverpflichtet. Jouke Wind kam per Sammeltransport am 27. Oktober
nach Deutschland, zunächst zur Eibia GmbH nach Bomlitz. Zwei Tage
später verschickte man ihn nach Liebenau, wo er im Haus 5 B des Steinlagers
Liebenau untergebracht und der Betriebsfeuerwehr des Werkes zugeteilt
wurde. In dieser Funktion hatte er Zugang zu allen Werksanlagen und sämtlichen
Lagern des Liebenauer Eibia-Komplexes. Er erlebte dabei die grausamen
Lebens- und Haftbedingungen im "Arbeitserziehungslager" Liebenau
indirekt mit, erinnert sich an die Erniedrigung und Misshandlung der Häftlinge
ebenso wie an einzelne Hinrichtungen. Er betont, dass seine damalige Situation
als Westeuropäer gegenüber den Polen und "Ostarbeiter/innen"
privilegiert war.
Das Foto
zeigt Jouke Wind (rechts), geboren am 01. März 1924 in Uereterp/Niederlande,
in Liebenau mit seinem damaligen besten Freund Folkert St. in der Uniform
der Eibia-Betriebsfeuerwehr. Jouke hatte zuvor im Raumausstattergeschäft
seines Vaters gearbeitet. Im Jahr 1941 überprüften deutsche
Besatzungsbehörden die niederländischen Betriebe und Unternehmen
der Umgebung gezielt nach "überzähligen" Arbeitskräften.
Die somit Aussortierten wurden zur Arbeit ins "Deutsche Reich"
zwangsverpflichtet. Jouke Wind kam per Sammeltransport am 27. Oktober
nach Deutschland, zunächst zur Eibia GmbH nach Bomlitz. Zwei Tage
später verschickte man ihn nach Liebenau, wo er im Haus 5 B des Steinlagers
Liebenau untergebracht und der Betriebsfeuerwehr des Werkes zugeteilt
wurde. In dieser Funktion hatte er Zugang zu allen Werksanlagen und sämtlichen
Lagern des Liebenauer Eibia-Komplexes. Er erlebte dabei die grausamen
Lebens- und Haftbedingungen im "Arbeitserziehungslager" Liebenau
indirekt mit, erinnert sich an die Erniedrigung und Misshandlung der Häftlinge
ebenso wie an einzelne Hinrichtungen. Er betont, dass seine damalige Situation
als Westeuropäer gegenüber den Polen und "Ostarbeiter/innen"
privilegiert war.
Pjotr
und Marija Samriha
Der Bauernsohn Pjotr Samriha, geboren am 16.06.1922 in Schyschkowzy, begann
im Jahr 1939 mit dem Ingenieurstudium in Kiew. Nach dem Überfall
der deutschen Truppen auf die Sowjetunion wurde er zur Armee einberufen.
Ende 1941 geriet er in deutsche Gefangenschaft, doch er konnte fliehen.
Im Mai 1942 wurde Pjotr Samriha zur Zwangsarbeit in die Pulverfabrik Liebenau
verschleppt und im "Ostarbeiterlager" Steyerberg interniert.
Als er sich nach wenigen Tagen gegen die miserable Behandlung auflehnte,
überstellte ihn die Gestapo für mehrere Monate in das "Arbeitserziehungslager"
Liebenau. Nach der Haft musste er bis zur Befreiung im Jahr 1945 im "Ostarbeiterlager"
bleiben.
Im gleichen Zeitraum war auch die am 01.08.1923 in Iwot geborene Marija
Denisenko im Steyerberger Lager als Zwangsarbeiterin der Pulverfabrik
interniert. Im Jahr 1944 verliebten sich die beiden jungen Menschen ineinander,
Marija wurde schwanger. Lagerleiter R. verlangte die Abtreibung, doch
die Befreiung verhinderte dies. Im Mai 1945 kam der Sohn in Steyerberg
zur Welt. Das Rentnerpaar Samriha lebt in einfachsten Verhältnissen
und hofft sehr auf die baldige Auszahlung der sehnlichst erwarteten Entschädigungszahlungen.
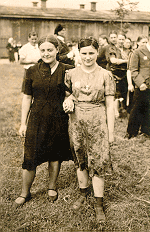 1942:
Marija Denisenko (links) mit einer Freundin nach der Ankunft im "Ostarbeiterlager"
Steyerberg. Im Hintergrund weitere sowjetische Zwangsarbeiter/innen der
Pulverfabrik Liebenau. Solche Aufnahmen wurden von deutschen Fotografen
gefertigt und verkauft.
1942:
Marija Denisenko (links) mit einer Freundin nach der Ankunft im "Ostarbeiterlager"
Steyerberg. Im Hintergrund weitere sowjetische Zwangsarbeiter/innen der
Pulverfabrik Liebenau. Solche Aufnahmen wurden von deutschen Fotografen
gefertigt und verkauft.
 1942:
Pjotr Samriha. Das Foto aus dem Betriebsausweis der Eibia GmbH.
1942:
Pjotr Samriha. Das Foto aus dem Betriebsausweis der Eibia GmbH.
Marcel
Regnault
 Marcel
Jean Regnault wurde am 24.01.1920 in Brassy/Frankreich geboren. Das Foto
zeigt ihn im im Jahr 1937 im Alter von 17 Jahren. Nach der Schule absolvierte
er eine Ausbildung zum Buchhalter. Am 8. Juni 1940 wurde er in der Region
von Grenoble zur französischen Armee eingezogen, nach der Unterzeichnung
des Waffenstilstandes mit den Deutschen aber wieder entlassen. Im November
1942 wurde Marcel Regnault zur Arbeit nach Deutschland dienstverpflichtet.
In Kassel zur Arbeit eingesetzt und dort "negativ" aufgefallen,
erfolgte die Verhaftung mit der Überstellung in das "Arbeitserziehungslager"
Liebenau (07. Januar 1943). Neben den deutschen Aufsehern sind ihm die
als Hilfskräfte der Wachmänner eingesetzten Mithäftlinge
F. und Sch. aufgrund ihrer besonderen Brutalität in besonderer Erinnerung.
Wenige Tage nach seiner Einlieferung erlebte er sadistische Quälereien
gegenüber einem jüdischen Mithäftling als Augenzeuge mit.
Bei seiner Entlassung wurde ihm verboten, über seine Inhaftierung
zu sprechen. Nach mehreren Arbeitseinsätzen im norddeutschen Raum
kehrte er im Mai 1945 nach Frankreich zurück.
Marcel
Jean Regnault wurde am 24.01.1920 in Brassy/Frankreich geboren. Das Foto
zeigt ihn im im Jahr 1937 im Alter von 17 Jahren. Nach der Schule absolvierte
er eine Ausbildung zum Buchhalter. Am 8. Juni 1940 wurde er in der Region
von Grenoble zur französischen Armee eingezogen, nach der Unterzeichnung
des Waffenstilstandes mit den Deutschen aber wieder entlassen. Im November
1942 wurde Marcel Regnault zur Arbeit nach Deutschland dienstverpflichtet.
In Kassel zur Arbeit eingesetzt und dort "negativ" aufgefallen,
erfolgte die Verhaftung mit der Überstellung in das "Arbeitserziehungslager"
Liebenau (07. Januar 1943). Neben den deutschen Aufsehern sind ihm die
als Hilfskräfte der Wachmänner eingesetzten Mithäftlinge
F. und Sch. aufgrund ihrer besonderen Brutalität in besonderer Erinnerung.
Wenige Tage nach seiner Einlieferung erlebte er sadistische Quälereien
gegenüber einem jüdischen Mithäftling als Augenzeuge mit.
Bei seiner Entlassung wurde ihm verboten, über seine Inhaftierung
zu sprechen. Nach mehreren Arbeitseinsätzen im norddeutschen Raum
kehrte er im Mai 1945 nach Frankreich zurück.
Ein
„Werksfriedhof“
In Hesterberg, unmittelbar am Rande des ehemaligen Eibia-Werkes, sind
auf einem Friedhof ungefähr 2.000 sowjetische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter/innen
sowie eine unbekannte Anzahl Polen begraben. Unter den Toten finden sich
in einer Ecke des Friedhofs auch polnische, jugoslawische und rumänische
Kinder. In einigen Gräbern sind im Zuge von Umbettungsmaßnahmen auch Opfer
aus der Zeit des Ersten Weltkrieges bestattet. Die Toten aus den „westlichen“
Ländern wurden auf dem Liebenauer Dorffriedhof nahe dem Bahnhof beerdigt.


![]()